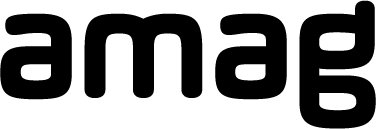Foto: Nadia Bendinelli
Prof. Axhausen: «Es ist inzwischen klar, dass uns der Umstieg auf den Elektroantrieb allein noch nicht ans Ziel bringen wird»
Redaktion Swiss-Architects
Foto: Nadia Bendinelli
Welche Rolle spielt das Auto heute in der Schweiz, Herr Axhausen?
Der Personenwagen ist das meistgenutzte Verkehrsmittel – sowohl was die Anzahl der Fahrzeuge als auch die gefahrenen Kilometer angeht. Über seine emotionale Bedeutung möchte ich mich nicht auslassen. Was denken Sie denn selbst dazu?
Gerade wenn ich wochenends mit dem Rennvelo unterwegs bin, gewinne ich den Eindruck, dass das Auto für viele Menschen – allen ökologischen Bedenken zum Trotz – weit mehr ist als ein Gebrauchsgegenstand: Es ist Statussymbol, Freizeitbeschäftigung und für einige sogar ein geliebtes Hobby. Darum kann ich nicht nachvollziehen, dass sich manche von der Einführung des Elektroantriebs eine grundsätzliche Veränderung des Verkehrsverhaltens, den Aufbau einer Sharing-Economy im Mobilitätsbereich und sogar eine sozialere und gemeinschaftsorientiertere Denkhaltung versprechen.
Diesen Wunsch, den Sie als naiv auffassen, kann ich durchaus nachvollziehen: Heute sind die meisten Autos mit nur einer Person besetzt. Das ist ein grosses Problem. Sharing und vor allem Pooling sind Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen und Fahrzeuge effizienter zu nutzen. Doch wird das in reichen Gesellschaften wie der unseren je im grossen Stil stattfinden? Es gibt weltweit viele erfolgreiche Pooling-Systeme: die Dolmus-Busse in der Türkei zum Beispiel oder die Kleinbusse in Afrika. Doch bedenken Sie, dass all diese Konzepte aus der Not geboren sind. Die Menschen haben in diesen Fällen kaum eine andere Möglichkeit, sich motorisiert fortzubewegen.
Wir haben uns in der Forschung intensiv mit Sharing- und Pooling-Systemen auseinandergesetzt und dabei auch deren Akzeptanz in der Bevölkerung untersucht. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass eine Flotte von elektrischen Taxis in Zürich eine beträchtliche Nachfrage erhalten würde, aber eben keine überwältigende. Es gibt hier klare Limiten. Man kann zwar zeigen, dass man nur rund ein Sechstel bis ein Siebtel der heutigen Autoflotte bräuchte, wenn alle Menschen mit gemeinschaftlich genutzten Taxis fahren würden, aber dieses Niveau des Zwangs ist schwer vorstellbar.
Auch beim Pooling gibt es Grenzen der Akzeptanz. Warum, ist uns noch nicht ganz klar. Zwar nutzen viele Menschen bereitwillig den Bus, wenn die Fahrzeuge aber kleiner werden, gibt es einen Punkt, an dem sich grösserer Widerstand bemerkbar macht. Möglicherweise wird es den Leuten ab einer gewissen Kleinheit des Fahrzeugs zu privat und zu intim.

Foto: Nadia Bendinelli

Foto: Nadia Bendinelli
Der Architekt Tobias Auch, mit dem wir für diese Artikelserie bereits ein Interview führen durften, sieht an dieser Stelle die Politik in der Pflicht. Ihm fehlt bisher die nötige Entschlossenheit ihrerseits, neue Mobilitätskonzepte durchzusetzen.
Nun, in Deutschland, aber auch in der Schweiz mit der nachgeordneten Zulieferindustrie, hängt ein substanzieller Teil der Industriearbeitsplätze am Personenwagen. Natürlich ist es schwierig, das zu ändern. Denn dann könnte weniger Geld verdient werden und möglicherweise würden Löhne und Gehälter sinken. Kurzum, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das Auto ein Erfolgsmodell gewesen. Doch kann es das in seiner heutigen Form bleiben?
Wie müssten Elektroautos denn künftig aussehen, damit wir unsere ökologischen Ziele eher erreichen können?
Es ist inzwischen klar, dass uns der Umstieg auf den Elektroantrieb allein noch nicht ans Ziel bringen wird. Es stecken so viel graue Energie und auch so viel graues CO2 im Fahrzeug selbst und in den Batterien, dass man damit unter heutigen Annahmen die CO2-Ziele nicht erreichen wird.
Hilfreich wäre, wenn die Fahrzeuge kleiner und leichter würden, sodass weniger Material in ihnen steckt. Doch nachdem wir in den letzten siebzig Jahren zugelassen haben, dass die Autos immer grösser, stärker und schwerer werden, ist das ein sehr schwieriger Schritt.
Warum entscheiden wir uns überhaupt dafür, ein eigenes Auto zu besitzen?
Eine einfache Frage, doch die Antwort ist komplex. Zunächst wissen wir aus der Forschung, dass die Menschen bei der Wahl des Verkehrsmittels kurzfristig auf die unmittelbaren Randbedingungen und Anreize reagieren, also auf Fahrzeit, Kosten, Verlässlichkeit, Bequemlichkeit und dergleichen. Dazu haben mein Lehrstuhl und auch viele andere etliche Studien vorgelegt.
Geht es um die Entscheidung für ein eigenes Auto, kommen viele verschiedene Faktoren zusammen. Ausschlaggebend ist beispielsweise, wo man wohnen und arbeiten möchte, aber auch wie schnell man unterwegs sein will. Wir haben auch hierzu bereits viel geforscht. Doch wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir als Gesellschaft die Randbedingungen radikal verschärfen würden, um Klima und Umwelt besser zu schützen.

Foto: Nadia Bendinelli
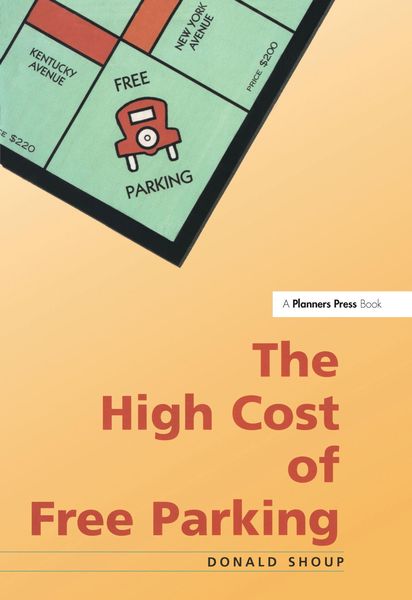
The High Cost of Free Parking
Donald Shoup
Buch in englischer Sprache
262 x 187 Millimeter
752 ページ
Gebundene Ausgabe
ISBN 9781884829987
University of Chicago Press
Purchase this book
Zu den wichtigsten Randbedingungen gehört das Parken. Viele Experten gehen davon aus, dass Immobilienbesitzer und Investoren ein grosses Interesse am Einbau von Ladestationen in ihre Häuser haben, um die Vermietbarkeit zu verbessern beziehungsweise zu erhalten.
Mag sein, doch das ist mit hohen Kosten verbunden. Es gibt mittlerweile eine intensive Debatte darüber, dass die Preise für das Wohnen und Parken voneinander getrennt gehören. Modelle, in denen der Mieter zwangsweise mit einem Parkplatz beglückt wird, für den er bezahlen muss, sind zu überdenken. Mir sind etliche Berichte über leerstehende Tiefgaragen bekannt, darüber, dass sich gerade in den Städten Vermieter beklagen, sie hätten teure Infrastruktur geschaffen, die ungenutzt bleibe. Wir müssen innehalten und die Bereitstellung von Parkraum einer kritischen Inventur zu unterziehen. Das gilt nicht nur für das Wohnumfeld. Wie viele Parkplätze braucht ein Supermarkt? Wie viele Mitarbeiterparkplätze soll ein Unternehmen vorhalten?
Ich bin der Überzeugung, man müsste künftig das Parken als Nutzung des begrenzten und wertvollen öffentlichen Raumes regulieren und Knappheitspreise zur Anwendung bringen. Wo die Nachfrage hoch ist, sollten die Preise entsprechend gestaltet sein.
Die Parkmöglichkeiten sind nur eine Stellgrösse. Wie beeinflussen neue Verkehrsmittel wie das E-Bike, das ja auch unter den Begriff Elektromobilität fällt, das Verhalten der Menschen?
Wir verfolgen aktuell gemeinsam mit Kollegen hier am Departement und neu auch einem aus Lausanne ein Forschungsprojekt namens E-Bike-City. Wir fragen uns dabei, inwiefern das E-Bike als zentrales Verkehrsmittel gedacht werden kann. Denn was städtische Geschwindigkeiten anbelangt, ist das E-Bike nicht ganz, aber doch im Wesentlichen mit dem Auto vergleichbar. Wir überlegen, ob ein entsprechender Umbau der Stadt, also die Reservierung signifikanter Teile der Verkehrsflächen für den Langsamverkehr, tatsächlich ausreichen würde, um genug Menschen dazu zu bringen, im Alltag mit dem E-Bike unterwegs zu sein und ihren 1,5 Tonnen schweren PKW gegen ein 25 Kilogramm leichtes Rad zu tauschen. Wir wissen nämlich aus der Literatur, dass viele Menschen bereit wären, mit dem Fahrrad zu fahren, es ihnen aber bisher schlicht zu unsicher ist.
Andere Länder, die Niederlande etwa, sind beim Ausbau ihrer Veloinfrastruktur weiter als die Schweiz. Welche Erkenntnisse lassen sich dort für die Umgestaltung der hiesigen Verkehrswege gewinnen?
Man sieht, dass in Städten, in denen mehr Infrastruktur vorhanden ist, auch mehr Rad gefahren wird. Aber selbst, wenn Sie sich Amsterdam oder Kopenhagen ansehen, werden die meisten Kilometer noch immer mit dem Auto zurückgelegt. Das heisst, das Fahrrad ist in den Augen der Menschen eine Alternative zum ÖV, kaum aber zum eigenen Wagen.

Foto: Nadia Bendinelli
Wie reagiert die Politik auf die Ihre Forschungsergebnisse und die von Ihrem Team geforderten Umbaumassnahmen? Sind Sie auf Basis Ihrer Untersuchungen beratend tätig?
Wir überprüfen mit studentischen Arbeiten die Planungen von Städten. Zum Beispiel haben wir in einer Arbeit des letzten Semesters ausgerechnet, was die Tempo-30-Planungen der Stadt Zürich in der Realität für die Geschwindigkeiten und die Erreichbarkeit bedeuten würden. Inwieweit derlei von den Behörden und Parteien aufgegriffen wird, vermag ich nicht zu sagen. Aber wir beraten weder den Bundesrat noch das Bundesamt für Strassen (ASTRA) bei politischen Fragen direkt. Dafür gibt es hierzulande technisch wie fachlich sehr gute Beratungsbüros.
Beim Projekt E-Bike-City sind wir gerade dabei, unsere Ergebnisse der (Fach)Öffentlichkeit vorzustellen. Wir wären sehr daran interessiert, mit Gemeinden zusammenzuarbeiten und gemeinsam über konkrete Planungen nachzudenken. Was wir bei diesem Forschungsprojekt in Simulationen testen und in Gestaltungsrichtlinien versuchen vorzudenken, ist freilich eine radikale Lösung. So etwas ist nicht von heute auf morgen umsetzbar und momentan wohl auch noch nicht mehrheitsfähig. Allerdings haben viele Städte während der Corona-Pandemie ihre Bemühungen verstärkt, ihre Radinfrastruktur auszubauen. Jedoch hat sich bisher keine Schweizer Stadt damit auseinandergesetzt, was ein Gesamtumbau bewirken würde. Hier wird aus unserer Sicht noch zu wenig nachgedacht.
Wir haben nun über die Hoffnungen gesprochen, die viele an die Elektromobilität knüpfen, und darüber, wie realistisch diese dem aktuellen Stand der Forschung nach sind. Noch nicht thematisiert haben wir indes selbstfahrende Elektroautos, die der nächste technische Fortschritt sein könnten, sofern die weitere KI-Entwicklung dies gestattet.
Das ist eine spannende Frage. An sich gibt es die Technologie bereits: Sie können nach Phoenix im US-Bundesstaat Arizona reisen und sich dort von einem autonomen Auto chauffieren lassen. Andererseits sind die entsprechenden Fahrzeuge noch nicht generell zugelassen und bis es so weit ist, wird es noch eine Weile dauern.
Ich hege aber Bedenken: Selbstfahrende Autos dürften zu einem noch höheren Verkehrsaufkommen führen. Wieso sollten Sie noch auf den Bus warten oder das E-Bike benutzen, wenn Sie ein autonomes Fahrzeug nach Hause bestellen können? Zudem haben solche Wagen bezüglich der CO2-Bilanz genau dieselben Probleme wie alle anderen Elektrofahrzeuge. Auch sie werden keine Lösung des Verkehrsproblems sein. Bei der Verlässlichkeit, der Stauanfälligkeit und hinsichtlich des Klimaschutzes lassen sich durch noch bequemeres, billigeres Fahren keine Verbesserung erzielen.
Herr Axhausen, vielen Dank für Ihre kritische Einordnung und den Einblick in Ihre Forschungsarbeit.
Professor Dr. Kay W. Axhausen lehrt und forscht aktuell am Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) der ETH Zürich. Er studierte an der Technischen Universität Karlsruhe und der University of Wisconsin in Madison. Er war an seiner Alma Mater, an der University of Oxford, am Londoner Imperial College of Science, Technology and Medicine sowie an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck tätig. An der Hong Kong University hatte er eine Gastprofessur inne. Die DTU im dänischen Lyngby verlieh ihm die Ehrendoktorwürde.
Weiterführende Literatur zum Thema:
Kay W. Axhausen, «The dilemma of transport policy making and the Covid-19 accelerator», in: Stephen Ison, Maria Attard und Jon Shaw (Hrsg.) «Transport and Pandemic Experiences», Emerald Publishing Limited, S. 39–51